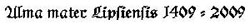
Dr. Johann Maier aus Eck, der Vizekanzler der Universität Ingolstadt, wird zu
einem der hartnäckigsten Gegner der Reformation aus dem gelehrten Lager.
Luther und Eck streiten anfangs mit handschriftlich verbreiteten
Streitschriften. 1518 greift Dr. Andreas Bodenstein von Karlstadt mit Thesen
gegen Eck in die Auseinandersetzung ein. Daraufhin fordert Eck eine
öffentliche Disputation. Im Oktober 1518 verhandelt Luther mit Eck in
Augsburg über Ort und Zeit des Streitgespräches. Eck entscheidet sich auf
Grund der antireformatorischen Haltung von Universität und Rat für Leipzig -
auch Erfurt stand zur Auswahl.
Während die Leipziger Universitätsleitung der Disputation zustimmt,
verweigert die Theologische Fakultät mit Unterstützung des Bischofs von
Merseburg die Genehmigung. Erst die Befürwortung durch Herzog Georg den
Bärtigen (Herzog im albertinischen Sachsen 1500 - 1539) läßt das Streitgespräch zustande
kommen. Herzog Georg weist Bischof Adolf am 17.Januar 1519 darauf hin, dass
"gar vil disputacion zcu leipczig ghalten de trinitate, de sacramento
ewcaristie vnd von an dern artikeln des glaubens vnd ist doch nimande kein
wegerung gschen, es ist och got lob kein entlich beschlosß wider kristlichen
glawben decemirt, sal och ab got wil forder nich gschen, hilten wir dor vor,
es sollt in dem ab eynn sele kegen himel fure, wen der pfennig im begken
klingt wol zu disputiren zcü lossen sein".
Am 21. oder 22. Juni 1519 trifft Eck in Leipzig ein und wird bei
Bürgermeister Benedikt Beringershain an der Ecke Petersstraße/Thomasgäßchen
aufgenommen.
Am folgenden Tage ziehen die Wittenberger in Leipzig ein. Im ersten Wagen
sitzt
Dr. Karlstadt, im zweiten Luther und Philipp Melanchthon mit Herzog Barnim
von Pommern (Rektor der Universität Wittenberg). Der Zug wird von 200
bewaffneten Wittenberger Studenten begleitet. Luther und seine Begleitung
nehmen bei Buchdrucker Melchior Lotter in der Hainstraße Quartier.
Die Hofstube der Pleißenburg wird von Herzog Georg als Ort für die
Disputation bestimmt - die Universität hatte auch das Gewandhaus und die
Barfüßerkirche vorgeschlagen. Hochlehnige Thronstühle sind für die
fürstlichen Personen bestimmt, zwei Katheder stehen sich für die Disputanten
gegenüber. An eichernen Tafeln schreiben vier Notare die Ausführungen mit.
Der Leipziger Universitätsprofessor Petrus Schade Mosellanus eröffnet die
Veranstaltung mit einer einstündigen Rede in Latein.
Eck und Karlstadt disputieren vom 27. Juni bis zum 3. Juli mit Ausnahme der
Festtage über den freien Willen und sein Verhältnis sowohl zur göttlichen
Gnade wie zu den guten Werken.
Am 4. Juli beginnt die Disputation zwischen Eck und Luther. Eck kämpft bei
der Auseinandersetzung über das Primat des Papstes und die Gewalt der
Konzilien mit allen Mitteln. So versucht er, Luther in die Nähe von Jan Hus
zu rücken und überzieht ständig seine Redezeit. Wütend ist er besonders auf
Melanchthon, der hinter Luthers Katheder sitzt, ihm zuflüstert oder Zettel
zusteckt. Auch Eck wird solche Unterstützung zuteil, die ausgewählten
Leipziger Theologen sind ihm jedoch wenig Hilfe, denn sie
"saßen allezeit neben Dr. Eckio und schliefen ganz sanft".
| Titelseite eines zeitgenössischen Druckes |
Am 15. Juli hält Johann Langius Lembergius, der Rektor der Universität Leipzig, die Schlußrede. Der Auftritt des Thomanerchores und der Stadtpfeifer unter Kantor Georg Rhau beenden die Disputation.
Beide Lager betrachten sich als Sieger in der Auseinandersetzung. Durch die Veröffentlichung der Disputationstexte in Erfurt und Paris sowie die Darstellungen Melanchthons wurden Luthers Auffassungen breit publiziert.
Mit seinem Bekenntnis, daß weder Papst noch Konzil höchste Autorität in Glaubensdingen besitzen und der Erklärung, daß nicht alle Gedanken von Hus ketzerisch sind, ist der Bruch des Reformators mit Rom endgültig vollzogen.
Damit war die Leipziger Disputation ein bedeutendes zeitgeschichtliches Ereignis für die Herausbildung und Verbreitung des Lutherischen Gedankengutes.


|