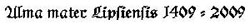
Die Einführung der Reformation in Leipzig
nach dem Tode Georgs des Bärtigen
nach dem Tode Georgs des Bärtigen
| Georg der Bärtige |
Kirchlichen Reformgedanken gegenüber war er zunächst nicht abgeneigt. Nach der Leipziger Disputation Luthers (1519), der er beiwohnte und die er befürwortet hatte, trat er allerdings mit aller Härte gegen die Protestanten auf.
Am 14./15.Mai 1525 besiegte er in der Schlacht von Frankenhausen die aufständischen Bauern in Thüringen und intensivierte im Dessauer Bund der katholischen Fürsten (1525) seinen Kampf gegen die Ausbreitung des Luthertums. Gleichzeitig wurde er, theologisch und humanistisch gebildet, in der Ausübung seines strengen landesherrlichen Kirchenregiments zu einem Vorkämpfer der als notwendig erachteten katholischen Reform (Klostervisitationen, -gründungen und -erneuerungen; theologische Schriften).
Da seine beiden Söhne vor ihm gestorben waren, wurde nach dem Ableben Georgs am 17. April 1539 dessen jüngerer Bruder Heinrich der Fromme sein Nachfolger. Dieser sah als das wichtigste Ziel seiner Innenpolitik die Einführung der lutherischen Reformation im albertinischen Sachsen an. Pfingsten 1539 wurde die Reformation in Leipzig mit einer Predigt Luthers in St. Thomae und Gottesdiensten in anderen Kirchen eingeführt.
Damit eröffnete sich der Universität die Möglichkeit zu einer grundlegenden Reform im Sinne der evangelischen Lehre nach dem Vorbild Wittenbergs. Allerdings war eine sofortige Verwirklichung dieses Vorhabens bei der wirtschaftlichen Lage und geistigen Verfassung der Universität nicht möglich. Das traf in erster Linie auf die fast ausgestorbene Theologische Fakultät zu. Beherrschendes Thema blieb auch die finanzielle Ausstattung. Die begonnene Säkularisierung der Klostergüter bot die
| Herzog Moritz |
Es zeigte sich, dass ebenso wie in der Religionsfrage Veränderungen nur mit landesherrlicher Unterstützung möglich waren. Die Universität hatte weder die innere Kraft noch die finanziellen Möglichkeiten sich selbst zu reformieren. Allerdings stand ab Herbst 1539 mit der Wahl Caspar Borners zum Rektor ein Mann an der Spitze der Universität, der in Zusammenarbeit mit Melanchthon und Joachim Camerarius die allgemeine Universitätsreform in zähen und langwierigen Bemühungen vorbereitete und 1544 zum Abschluss brachte.
Am 18 August 1541 übernahm Herzog Moritz für seinen verstorbenen Vater die Regierung und zu seinen vorgefundenen unerledigten Problemen gehörte die anstehende Reform der Landesuniversität.


|